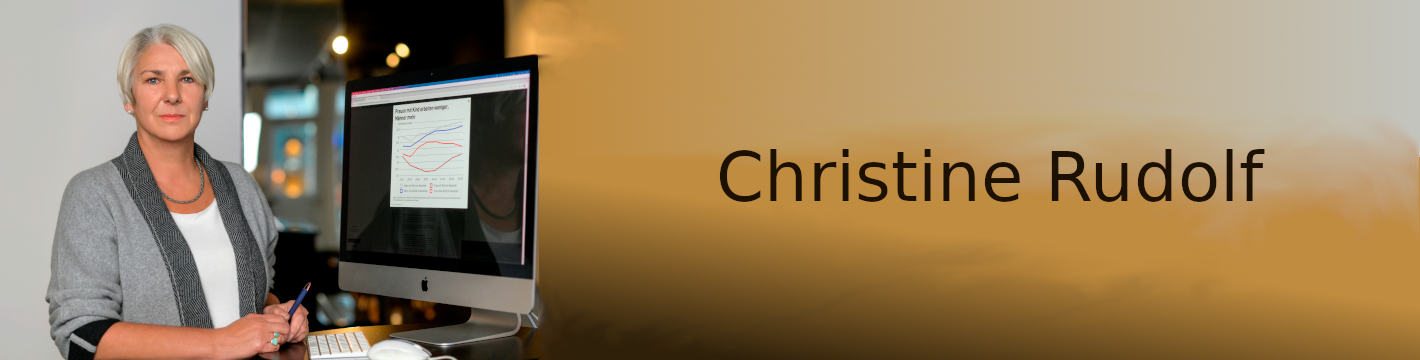Ein wichtiges Thema, so die meist erste Bemerkung auf die Erwähnung meines Buches. Doch was ist daran wichtig? Lesen sie selbst:
„In Deutschland liegt der durchschnittliche Stundenlohn von Frauen um rund 22 Prozent unter dem der Männer. Damit gehört Deutschland zu den Staaten mit der größten Ungleichheit bei der Bezahlung von Männern und Frauen.“ Dieses Zitat stammt nicht aus den Fünfzigerjahren, sondern von EU-Sozialkommissar Vladimir Spidla vom Juni 2008.[1]
Der Meldung folgte – wie üblich an dieser Stelle – ein kurzer Sturm im Blätterwald, in dem einerseits der Empörung über diese materielle Ungerechtigkeit Ausdruck gegeben wurde, gleichzeitig aber auch ins Feld geführt wurde, dass von einer Diskriminierung aufgrund des Geschlechts ja nicht gesprochen werden könne, da es durchaus Gründe für diese Unterschiede gebe: Berufswahlverhalten, Teilzeitarbeit, Ausfallzeiten wegen Kindererziehung, Angst vor Gehaltsverhandlungen, zu wenig Karrierestreben etc. Mithin: die Frauen sind selbst daran schuld, dass sie weniger verdienen.[2]
Dahintersteckt eine Frage, auf die wir beim Thema „Frauen und Geld“ immer wieder gestoßen sind: Liegt es an den Frauen selbst, dass sie kein Geld haben oder werden sie seit Jahrhunderten davon abgehalten es zu erwerben und zu besitzen? Geht es also um Mentalität oder um Macht? An den Zahlen selbst gibt es ja wenig zu deuteln: Im 1. Quartal 2008 lag der durchschnittliche Bruttoverdienst einer vollzeitbeschäftigten Frau bei 2570 Euro, derjenige eines Mannes bei 3259 Euro.[3] Bei dieser Statistik handelt es sich ausschließlich um den Vergleich zwischen vollerwerbstätigen Menschen, der einkommenssenkende Effekt von Teilzeitarbeit kommt dabei also noch gar nicht zum Tragen. Der tatsächliche Verdienst vieler Frauen, deren Lebenswirklichkeit durch unbezahlte Reproduktionsarbeit, Teilzeitarbeit und geringfügige Beschäftigung geprägt ist, liegt also noch deutlich unter diesen Summen.
Haben Frauen kein Geld, weil sie sich mehr für die Liebe als für Machtkämpfe interessieren, weil ihnen Harmonie wichtiger ist als Erfolg und sie in den entscheidenden Momenten zu früh einlenken oder es gar nicht zum Konflikt kommen lassen – letztlich also für die „harte Welt des Geldes“ nicht geeignet sind? Diese Ansicht ist weit verbreitet und geht mit der Überzeugung einher, dass Männer und Frauen grundsätzlich verschieden sind – mit Unterschieden, die früher aus der göttlichen Ordnung oder der Naturordnung abgeleitet wurden und heute in den Genen gesucht werden.
Gehen wir hingegen davon aus, dass Männer und Frauen sich durch ihre Erziehung und die gesellschaftliche Stellung, die ihnen zugewiesen wurde und wird, unterscheiden, dann rücken vor allem die rechtlichen Verhältnisse ins Blickfeld, die Frauen Jahrhunderte lang systematisch und weitgehend von Besitz ausschlossen. Als Ehefrauen und Töchter unterlagen sie mit ihrem Vermögen und ihrer Arbeitskraft den patriarchalischen Familienstrukturen in Form der Kontrolle durch den Vater und Ehemann – Rechtsnormen, deren Relikte bis weit in die Bundesrepublik hineinüberdauerten.[4]Damit ist das Verhältnis von Frauen und Geld in erster Linie als eine Geschichte der Unterdrückung, Enteignung und Enterbung zu lesen.
Gemeinsam ist beiden Sichtweisen, dass sie das Verhältnis, das Frauen und Geld verbindet, nicht als eine Historie des Reichtums, sondern als eine Armutsgeschichte sehen.
[1] Süddeutsche online vom 9.6.2008, http://www.sueddeutsche.de/jobkarriere/artikel/628/179080/?CMP=NLC-SDE071022&nlsource=taeglich, 15.07.08.
[2] „ZEIT: Sind Frauen selbstdaran schuld, dass sie weniger verdienen als Männer? Cornelia Topf: Ja, klar! Für viele ist Geld ein Tabuthema. Häufig sind sie auch zu bescheiden, oder es ist ihnen peinlich, mehr zu fordern.“ aus: Gleiche Leistung, weniger Lohn. Interview von Alexandra Endres mit der Beraterin Cornelia Topf, ZEIT online, 7.03.08, http://www.zeit.de/online/2008/10/interview-frauen-gehaltscoach?from=24hNL,15.07.08
[3] Die Zahlen beziehen sich auf Vollzeitbeschäftigte im produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich ohne Beamte und öffentlichen Dienst (jeweils ohne Sonderzahlungen) und stammen von der Internetseite des Statistischen Bundesamtes, http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Statistiken/VerdiensteArbeitskosten/Bruttoverdienste/AktuellZusatz,templateId=renderPrint.psml#Fussnote%201,15.07.08.
[4] So z.B. der so genannte Stichentscheid in Fragen der Erziehung, der 1959 durch ein Urteil des Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt wurde (vgl. auch Ute Gerhard, Unerhört. Die Geschichte der deutschen Frauenbewegung, Reinbek bei Hamburg 1990, S. 230–231).